Sängerin
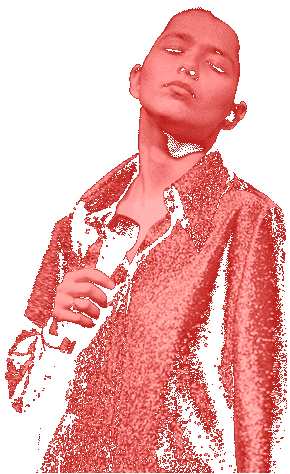
Stellen wir uns folgendes vor: im 20. Jahrhundert wird ein neues Gesellschaftsspiel, eine neue Kunstform, erfunden. Angekündigt ist ein Kinofilm mit dem Titel „Großstadtlabyrinth“, der uns interessiert, da er von einem beliebten Regisseur und Schauspieler gedreht worden ist. Sehen wir uns das Ereignis näher an: Gegen 21 Uhr 30 findet sich der Großteil des Publikums ein, obwohl im Programm eindeutig „Beginn 21 Uhr“ zu lesen war. Das scheint niemanden zu stören; es ist vielmehr so, daß dies üblich ist: Die Veranstalter wissen, daß das Publikum sich immer etwa eine halbe Stunde später einfindet, während sich die Gäste sicher sind, daß der Film ohnehin erst gegen halb zehn beginnt. Entscheidend ist, daß es bei diesem Film auch keine große Rolle spielt, wenn man zu spät kommt, da er aus ineinanderfließenden Kurzgeschichten, Stimmungen, Unterhaltungen, stehenden Bildern, sagen wir, wie eine großartige Collage zusammengestellt ist. Würden wir den Beginn verpaßen, so könnten wir dennoch das weitere Geschehen verfolgen, ohne uns die ganze Zeit fragen zu müßen, wer da eigentlich wen und wie am Anfang umgebracht hat (das Ärgernis, die entscheidenden Minuten beim Krimi verpaßt zu haben, kennen wir). Unser Verlust wäre also lediglich quantitativer Art.
Auch der Ort des Geschehens ist nicht ganz gewöhnlich: Wir befinden uns auf einem Filmgelände, in dessen Mitte eine Kinoleinwand aufgestellt ist. Der Besucher kann sich hier überall umschauen oder, wie gewohnt, vor der Leinwand des Freiluftkinos Platz nehmen.
Der Regisseur hat sich einer bekannten Thematik angenommen, die vor ihm schon Woody Allen, Wim Wenders, Frederico Fellini, Martin Scorcese, Luc Besson und Fritz Lang in unterschiedlichster Weise künstlerisch umgesetzt haben. Wir können also gespannt sein auf ein neues Werk über den Menschen in der Großstadt, seine Ängste und Sehnsüchte, Alltagsgeschichten und Romanzen. (Und wir haben eventuell das dumpfe Gefühl, wir könnten schon vorausahnen, was der „Autor uns sagen will“, wenn er beispielsweise eine desperate Liebesgeschichte zwischen zwei neurotischen „Großstadtindianern“ erzählen wird.
Aber es kommt alles anders!
Einige Kameraleute sowie Ton- und Lichtassistenten betreten das Areal, mit ihnen Schauspieler und Musiker, sogar der Regisseur. Ein erster Applaus setzt ein, noch bevor der Film begonnen hat. Der Regisseur und seine Mitstreiter verneigen sich und alle, sogar die Kabelträger, werden vom Regisseur mit Namen vorgestellt. Doch von nun an verliert sich die eindeutige Funktion eines jeden: Wer vorher hinter der Kamera stand, steht plötzlich davor, während der Regisseur in eine Nebenrolle schlüpft, die ein anderer verlaßen hatte, um eine dramatische Hauptrolle zu übernehmen. Die Thematik hatte der Regisseur zwar, wie wir wissen, ausgegeben, aber weder eine feste Handlung oder Kameraeinstellungen, noch eine konstante Rollenverteilung vorgeschrieben. Alle gemeinsam schöpfen aus dem Moment heraus ihre Vision der Grosßtadt.
Auch wenn der Regisseur die zeitgleich auf der Leinwand übertragenen Bilder selbst am Schnittmonitor aussucht, hat er nun keinen Einfluß darauf, welche Bilder ihm von den Kameraleuten angeboten werden. Denn diese verfolgen das unvorhersehbare Geschehen jeweils aus subjektiver Sicht und ihren persönlichen Fähigkeiten gemäß.
So sind manche Szenen nur visuell wahrzunehmen, da der Mann vom Ton beispielsweise das Gespräch der Männer am Nachbartisch für eindrucksvoller gehalten hatte, während ein anderer einen Zuschauerruf einfängt. Oder wir hören die Stimme der vermeintlichen Hauptdarstellerin, die das Klirren des zu Boden fallenden Bierglases eines begeisterten Fans ironisch kommentiert. In anderen Momenten fügen sich Bild, Ton, Musik und Darstellung wie durch magische Kraft zusammen. Beide Formen sind Facetten eines Gesellschaftsspiels, ganz gleich ob mit-, neben- oder gegeneinander gespielt wurde.
Nun hat der Zuschauer, während er all dies auf der Leinwand verfolgt, auch die Möglichkeit, die Künstler zugleich beim Spielen zu beobachten. Man könnte sagen, der Prozess des Spielens und das Ergebnis als Kinofilm fallen zeitlich und räumlich zusammen, und gemeinsam bilden sie das, was wir an diesem Abend als Erlebnis mit nach Hause nehmen.
Sie würden an einem offensichtlich so chaotischen Ereignis nicht teilnehmen wollen? Ich auch nicht.
Oder doch?